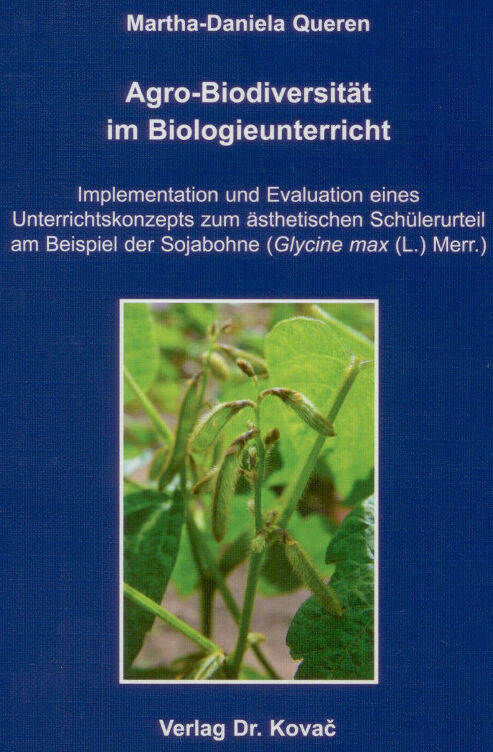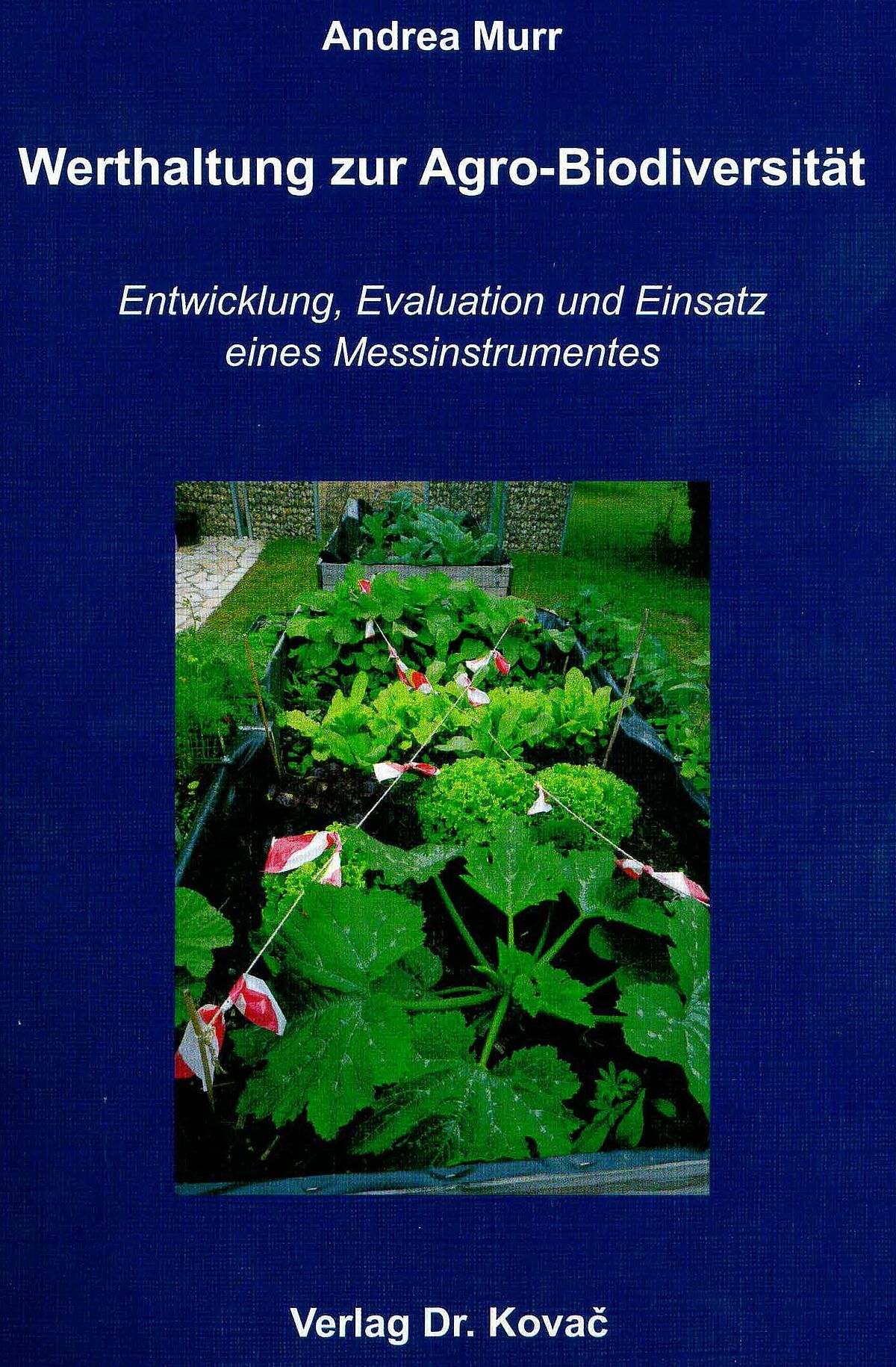Agrobiodiversität
„Unter dem Begriff ‚Agro-Biodiversität’ versteht man zunächst die Vielfalt der durch aktives Handeln des Menschen für die Bereitstellung seiner Lebensgrundlagen unmittelbar genutzten und nutzbaren Lebewesen: der Kulturpflanzen (einschließlich ihrer Wildformen), der Forstpflanzen, der Nutztiere, der jagdbaren und sonstigen nutzbaren Wildtiere, der Fische und anderer aquatischer Lebewesen sowie der lebensmitteltechnologisch und anderweitig nutzbaren Mikroorganismen und sonstigen niederen Organismen“ (BMELV, 2007, S.9).
Die Agrobiodiversität lässt sich in drei Bedeutungsbereiche einteilen:
- Ökonomisch: Agrarisch genutzte Bestandteile der biologischen Vielfalt haben aufgrund des Marktwertes der damit erzeugten Produkte eine erhebliche ökonomische Bedeutung. Nach Untersuchungen der BMELV (2007) beträgt der Produktionswert der deutschen Landwirtschaft rund 43 Mrd. Euro, der Forstwirtschaft rund 3 Mrd. Euro und der Fischerei rund 0,2 Mrd. Euro.
- Ökologisch: Unter dem ökologischen Schwerpunkt des Begriffs versteht man die Artenvielfalt, ihre optimalen Bedingungen unter denen sie wachsen, ihre genetischen Ressourcen und deren Einsatz für die Herstellung neuer Arten. Nach der DGNV (deutsche Gesellschaft für die vereinten Nationen e.V.) (2010) verringert sich die Biodiversität täglich. Schätzungen zufolge sterben 130 Arten am Tag.
- Sozial: Die Agro-Biodiversität beinhaltet auch kulturelle und ästhetische Werte. Alte Haustierrassen, traditionelle Arten und Sorten von Kulturpflanzen zeugen von kulturellen Leistungen früherer Generationen und der historischen Entwicklung des Landbaus und der Tierhaltung der Region. Zudem bildet die Natur, in die auch Agrarlandschaften integriert sind, einen Erlebnis- und Erholungsort für den Menschen, den er nutzt und braucht.
Werthaltung von Oberstufenschüler*innen zur Agrobiodiversität am Beispiel der Kartoffel (Solanum tuberosum)

Das BMELV hat die Forschung zum Erhalt, Bewertung und Nutzpflanzen und tiergenetischer Ressourcen zu einem Aktivitätsschwerpunkt erklärt und die Vielfalt-Kampagne „Agrobiodiversität“ ins Leben gerufen (BMELV 2010). Es besteht aber weder ein übergreifendes Bewusstsein für den Wert biologischer Vielfalt, noch sind einzelne Facetten der Problematik, wie z.B. die Agro-Biodiversität, ins Bewusstsein der Bevölkerung vorgedrungen (Kleinhückelkotten 2008). Empirisch validierte Testinstrumente zur Erfassung der Werthaltung zum Thema Agro-Biodiversität sind nicht vorhanden. Entsprechend steht die Entwicklung und Validierung eines standardisierten Testinstrumentes im Zentrum der empirischen Studie.
Forschungsdesign und -methodik
Auf Grundlage eingehender Literaturrecherche wurden Skalen und Items für die einzelnen Wertkategorie gebildet, die anschließend in einer Expertenbefragung auf ihre Zugehörigkeit zu den Itemspools validiert wurden. Anschließend wurde der Fragebogen entwickelt und im Rahmen eines Pre-Testes in Bezug auf die Gütekriterien überprüft. Nach dieser Überarbeitung und Optimierung des Fragebogens wird im Frühsommer 2014 eine Ist-Stand-Erhebung der Wertvorstellungen von Oberstufenschülern zu Agro-Biodiversität vorgenommen. Auf Grundlage der Ergebnisse werden Vorschläge für die Entwicklung einer entsprechende Unterrichtsintervention abgeleitet mit dem Ziel die Wertvorstellungen von SchülerInnen in Bezug auf Agro-Biodiversität zu erweitern, um die Entwicklung nachhaltigen Umwelthandelns zu fördern.
Literatur
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2010). Agrobiodiversität erhalten, Potentiale der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft erschließen und nachhaltig nutzen. Bonn: BMELV.
Kleinhückelkotten, S. (2008): Zielgruppengerechte Kommunikation zu (Agro-)Biodiversität. BNE-Journal, Online-Magazin 'Bildung für nachhaltige Entwicklung', Ausgabe 3, Mai 2008.
Foto
© Dr. M. Feike